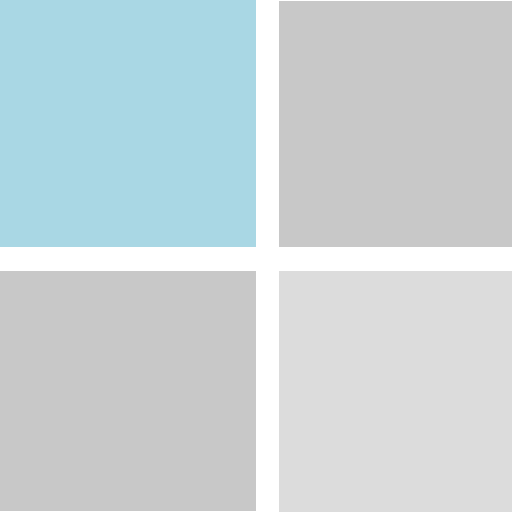Das Licht schmeckt nach Kupfersulfat und verbranntem Silizium. Ich stehe hier, wo die Straße ihre Geometrie verliert, wo der Asphalt aufhört, fest zu sein, und anfängt zu atmen – langsam, rhythmisch, wie ein Organismus in Narkose. Die Laternen über mir sind keine Lichtquellen mehr, sie sind Fisteln im Fleisch des Himmels, durch die etwas Radioaktives sickert, etwas, das früher vielleicht Hoffnung war, bevor es die kritische Masse erreichte und zu dieser orangefarbenen Malignität mutierte.
Der Himmel selbst ist eine chemische Reaktion in Echtzeit. Ich sehe, wie sich Kobaltblau und Cadmiumorange in fraktalen Mustern vermischen, eine Oxidation der Atmosphäre, die Brandblasen wirft wie versengte Haut. Es riecht nach Ozon und nach etwas Süßlichem, das nicht süß sein sollte – nach Glykol vielleicht, nach Kühlflüssigkeit, die aus den Venen dieser Stadt läuft. Die Türme in der Ferne sind keine Architektur, sie sind Knochenauswüchse, kalzifizierte Träume von Vertikalität, die der Leviathan aus seinem Rückgrat getrieben hat.
Ich bin eine Silhouette. Mehr nicht. Ein Schatten, der sich erinnert, einmal dreidimensional gewesen zu sein, bevor die Stadt mich in ihre zweidimensionale Syntax übersetzte. Mein Mantel – wenn es überhaupt ein Mantel ist und nicht nur eine Datenbeschädigung in der Textur der Realität – flattert ohne Wind. Die Luft hier ist zu dick zum Flattern, zu ölig, zu sehr mit Partikeln gesättigt, die ich nicht benennen will, weil Namen Macht haben und ich dieser Materie keine Macht über meine Lungen geben möchte.
Die Straße vor mir ist eine Gleichung ohne Lösung. Sie führt zu den Türmen, aber ich weiß, dass Führen hier eine relative Größe ist, abhängig von Variablen, die sich ständig ändern. Die Laternen markieren keine Wegpunkte, sie sind Koordinaten in einem anderen System, einem, das nicht euklidisch ist, wo parallele Linien sich sehr wohl schneiden können und wo der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten durch die Eingeweide der Zeit führt.
Rechts von mir, am Straßenrand, steht etwas, das einmal ein Auto war. Jetzt ist es ein Sarkophag aus Metall und zerbrochenem Glas, ein Container für Erinnerungen, die nie stattgefunden haben. Sein Schatten ist länger als er selbst sein sollte, und ich sehe, wie sich dieser Schatten bewegt – nicht mit der Lichtquelle, sondern gegen sie, als hätte er seinen eigenen Willen, seine eigene Agenda in dieser Welt aus erstarrtem Moment.
Der Baum links, nackt und skelettiert, ist kein Baum. Er ist ein neuronales Netzwerk, das vergessen hat, wie man Blätter produziert, wie man Photosynthese betreibt. Seine Äste sind Synapsen, die ins Leere feuern, die Impulse in einen Himmel senden, der nicht mehr antwortet. Ich höre ihn manchmal flüstern, in einer Sprache aus Rauschen und Interferenzen, und ich verstehe nicht, was er sagt, aber ich spüre die Dringlichkeit seiner Botschaft in meinem Knochenmark.
Die Fenster der Türme sind Augen, aber nicht lebendige Augen – sie sind Augen nach der Lobotomie, nach der Exstirpation dessen, was einmal Bewusstsein war. Sie reflektieren das sterbende Licht nicht, sie absorbieren es, ziehen es in sich hinein wie schwarze Löcher in einem urbanen Kontinuum. Ich frage mich, ob hinter diesen Fenstern Menschen leben oder ob die Stadt längst gelernt hat, Menschen zu simulieren, Algorithmen zu generieren, die so gut sind, dass selbst die Algorithmen nicht mehr wissen, dass sie Algorithmen sind.
Das Wasser auf dem Asphalt – denn es muss Wasser sein, obwohl es die falsche Viskosität hat, die falsche Farbe, den falschen Brechungsindex – spiegelt die Laternen in einer Weise, die die Gesetze der Optik verhöhnt. Die Spiegelungen sind schärfer als die Originale, detaillierter, als wären sie die Realität und die Laternen über mir nur schwache Projektionen aus einer niedrigeren Dimension.
Ich atme, weil ich muss, nicht weil ich will. Die Luft füllt meine Lungen wie Injektionsharz, härtet dort aus zu kleinen Skulpturen der Resignation. Meine Haut ist nicht mehr meine eigene Grenze – sie ist porös geworden, durchlässig für die Frequenzen, die diese Stadt aussendet. Ich bin ein Schwamm für ihre Toxizität, ein Filter, der nichts filtert, sondern nur sammelt und speichert.
Die Zeit hier bewegt sich nicht linear. Sie oszilliert, schwingt zwischen Momenten hin und her wie ein Pendel in einem viskosen Medium. Ich bin gleichzeitig angekommen und noch nicht aufgebrochen, bin gleichzeitig tot und noch immer im Sterben begriffen. Der Horizont, wo das Orange in Purpur übergeht und dann ins absolute Schwarz kollabiert, ist nicht mehr erreichbar – er ist ein Ereignishorizont im wörtlichen Sinne, eine Grenze, hinter der die Kausalität ihre Gültigkeit verliert.
Und ich stehe hier, in der Mitte dieser Straße, die keine Straße mehr ist, sondern eine Narbe im Gewebe der Stadt, und warte. Worauf, weiß ich nicht. Vielleicht darauf, dass die Türme endlich vollständig aus dem Fleisch der Erde brechen. Vielleicht darauf, dass das Licht seinen letzten Phasenübergang vollzieht und zu etwas wird, das kein Licht mehr ist. Vielleicht einfach darauf, dass die Entropie ihr Maximum erreicht und alles – die Stadt, ich, die Differenz zwischen Stadt und Ich – in einen Zustand perfekter, bedeutungsloser Homogenität zerfließt.
Die Laternen flackern. Nicht synchron. Jede nach ihrem eigenen Todeskampf-Rhythmus. Und ich verstehe: Dies ist nicht der Weg nach Hause. Dies ist der Ort, wo das Konzept von „Zuhause“ seine chemische Struktur verliert und zu etwas anderem wird. Zu einem Toxin. Zu einer schönen, unheilbaren Krankheit.
Ich bleibe stehen. Weil Gehen und Stehenbleiben hier dasselbe ist. Weil Bewegung eine Illusion ist in einer Welt, die sich nur um ihre eigene kranke Achse dreht.