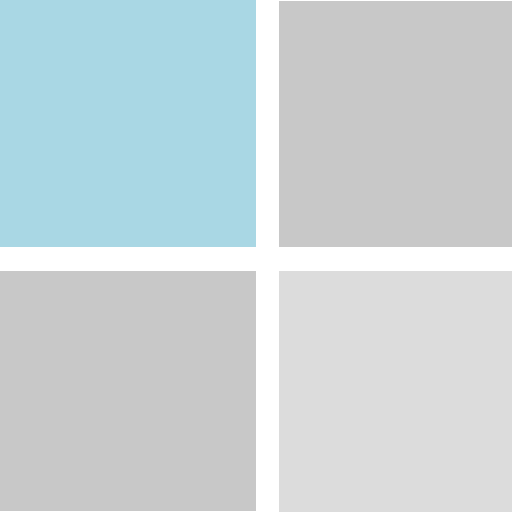Salz auf der Zunge
Der Himmel ist ein einziger, grauer Klumpen. Er hängt tief, so tief, dass ich ihn fast schmecke, dieses metallische, nasse Versprechen von mehr Regen. Ich stehe hier, auf diesem nassen, glitschigen Beton, der ins Meer abfällt. Eine alte Slipanlage, mehr ist das nicht. Der Wind zieht durch die Klamotten, kalt und salzig. Das ist das Erste, was ich rieche: Salz und Moder, das stinkt nach Ebbe und nach dem, was das Meer nicht mehr will.
Ich schaue rüber zu den Häusern. Weiß getüncht, mit diesen dunklen Dächern, kleben sie da drüben am Kai, kauern unter dem Kirchturm. Sie sehen aus, als hätten sie schon tausend Stürme überlebt. Und ich? Ich stehe hier und warte. Auf was, weiß ich nicht genau. Die Suche, sagen sie, ist das Ziel. Ein blöder Spruch, aber heute fühlt er sich wahr an. Ich suche nicht nach einem Schatz oder einer verlorenen Liebe. Ich suche nach einem Anker.
Das Wasser ist dunkel, fast schwarz, nur die kleinen Wellen, die gegen den Beton schlagen, sind silbern. Es rauscht leise, ein monotones, dumpfes Geräusch, das alles andere schluckt. Kein Schreien, kein Lachen. Nur das Meer.
Plötzlich, da drüben, im seichten Wasser: Der Hund. Ein brauner Wirbel, der rennt, die Beine hochgerissen, als würde er über das Wasser fliegen. Er jagt irgendwas, einen Fisch, einen Schatten, oder einfach nur die pure Bewegung. Er ist völlig in seinem Moment, frei von diesem ganzen grauen Gewicht, das auf mir lastet. Er spritzt das Wasser auf, ein kleiner, goldener Funke in dieser Melancholie.
Ich sehe ihm nach. Er sucht auch. Aber seine Suche ist einfach, körperlich. Meine ist so verdammt kompliziert, so kopflastig. Ich spüre die Kälte jetzt in den Knochen, nicht nur auf der Haut. Ein dumpfes Ziehen im Bauch. Hunger? Oder einfach nur die Leere, die ich mit mir rumtrage?
Ich atme tief ein. Der Geruch von Jod und nassem Stein füllt meine Lungen. Ich bin hier. Das ist alles, was zählt. Ich bin nicht weiter, aber auch nicht zurück. Ich stehe fest auf diesem nassen, kalten Beton. Der Hund ist jetzt fast am Ufer, schüttelt sich kurz und rennt weiter, verschwindet hinter einem Felsen.
Ich bleibe stehen. Die Suche geht weiter. Aber vielleicht, denke ich, vielleicht muss ich nicht so schnell rennen wie der Hund. Vielleicht reicht es, einfach nur zu gehen. Langsam. Schritt für Schritt. Und zu warten, bis der Himmel endlich aufreißt. Oder bis der Regen kommt. Ist mir auch egal. Hauptsache, es passiert was. Jetzt erst mal ’ne Kippe. Das ist der Plan. Der Einzige, der gerade zählt.
Pflaster und Regen
Ich stehe hier, wo das Pflaster nass ist und die Welt nur noch aus Grau besteht. Der Regen schlägt hart auf die Steine, ein Geräusch, das sonst niemand hört. Das ist gut. Es ist mein Geräusch. Ich bin oft allein unterwegs, und diese Orte, diese stillen, feuchten...
Mit Claire im le petit-rien
Der Geruch von altem Holz und abgestandenem Bier klebt in der Luft, ein schwerer, ehrlicher Duft, der sich in die Dielen gefressen hat. Ich stehe hier, die Hände auf dem rauen Tresen, und starre in das gleißende Nichts am Ende des Raumes. Es ist das „Le Petit Rien“,...
Die Stadt der Totengräber
Ich bin wieder unterwegs. Muss ich ja. Die Straße hier, die ist aus altem, nassem Pflasterstein. Sie glänzt schwarz, schluckt das wenige Licht, das durch diesen dicken, grauen Himmel sickert. Es ist nicht viel Regen, eher so ein feiner, kalter Sprühnebel, der sich überall festsetzt. Ich ziehe den Kragen meines Mantels hoch, obwohl es eh nichts bringt. Der Stoff ist schon durch, saugt die Feuchtigkeit auf wie ein alter Schwamm.
Der Ereignishorizont der Straßenlaternen
Das Licht schmeckt nach Kupfersulfat und verbranntem Silizium. Ich stehe hier, wo die Straße ihre Geometrie verliert, wo der Asphalt aufhört, fest zu sein, und anfängt zu atmen – langsam, rhythmisch, wie ein Organismus in Narkose. Die Laternen über mir sind keine Lichtquellen mehr, sie sind Fisteln im Fleisch des Himmels, durch die etwas Radioaktives sickert, etwas, das früher vielleicht Hoffnung war, bevor es die kritische Masse erreichte und zu dieser orangefarbenen Malignität mutierte.
Stadt-ein-Kadaver-in-Neon
Der Asphalt glänzt nasskalt unter meinen Füßen, ein schwarzer Spiegel für das sterbende Licht des Tages. Die Luft schmeckt nach feuchter Erde und dem fernen, metallischen Geruch der Stadt – eine Mischung aus Regen und Rost. Ich stehe mitten auf der Straße, als wäre sie nur für mich gemacht. Ein seltsames Gefühl. Die Laternen werfen lange, orangefarbene Arme aus, die sich auf dem Boden winden wie hungrige Schlangen. Sie zischen leise, ein kaum hörbares Summen, das sich mit dem fernen Rauschen des Verkehrs vermischt.
Die Architektur des Verfalls
Die Kälte, die mich umfängt, ist keine bloße Temperatur der Nacht, die sich in den feuchten, glänzenden Asphalt dieses Hinterhofs frisst, sondern die existenzielle Kälte selbst, die aus den tiefsten Rissen meiner Knochen aufsteigt und sich wie ein metallischer Geschmack, ein fauliger Hauch von Kupfer und Verzweiflung, auf meiner Zunge festsetzt, während mein Blick an der endlosen Gitterstruktur der Fabrikfassade hängenbleibt, deren tausend Fenster wie blinde, vernarbte Augen die Leere meiner inneren Landschaft widerspiegeln. Jeder Schritt, den ich auf diesem nassen, spiegelnden Boden setze, ist ein dumpfer Schlag, der durch die Schwere meiner Glieder hallt, ein Gewicht, das nicht nur das meines Körpers ist, sondern die kumulierte Last aller ungelebten Tage, die sich in meinen Gelenken als ein unerbittlicher, dumpfer Druck manifestiert, als würde das Fundament meines Fleisches langsam unter der Last des Bewusstseins nachgeben.
Morgen nach dem Sturm
Der Sand ist nass und kalt unter meinen Stiefeln. Er knirscht nicht, er seufzt nur leise, wenn ich das Gewicht verlagere. Ich stehe hier, wo die letzte Welle des Sturms von gestern Nacht ihre Spur hinterlassen hat. Die Sonne kämpft sich gerade durch diesen grauen, schweren Himmel, wirft ein kaltes, gleißendes Licht auf das aufgewühlte Meer. Es ist diese Stunde, in der die Welt noch nicht ganz wach ist, und ich bin allein. Wie so oft.
Ich rieche Salz, Jod und etwas Moderiges, Altes, das der Ozean immer wieder ausspuckt. Es ist ein ehrlicher Geruch, unverblümt. Die Gischt peitscht gegen die Felsen da drüben, diese dunkle, zähe Masse, die sich gegen alles stemmt. Das Geräusch ist ein tiefes, konstantes Rauschen, ein Bass, der alles andere übertönt. Es ist kein beruhigendes Geräusch, eher eine Mahnung.
Montmartre, ein Dienstagabend
Der Regen hat gerade aufgehört. Ich stehe hier, am Rand dieses schmalen Pflasters, und sehe zu, wie das Licht die Straße aufsaugt. Es ist dieses schmutzige, goldene Leuchten, das nur alte Pariser Cafés hinkriegen. Ein warmer, fast schon unverschämter Schein, der sich...
Moguéran
Ich sitze hier. Der Stuhl ist hart, das Tischtuch blendend weiß. Ein absurder Kontrast zu dem, was drumherum passiert. Die Sonne, dieser orangefarbene Klotz, versinkt gerade im Meer, zieht das ganze Wasser mit sich in diesen irren, goldenen Sog. Es ist lautlos, aber ich spüre das Ziehen in der Brust.